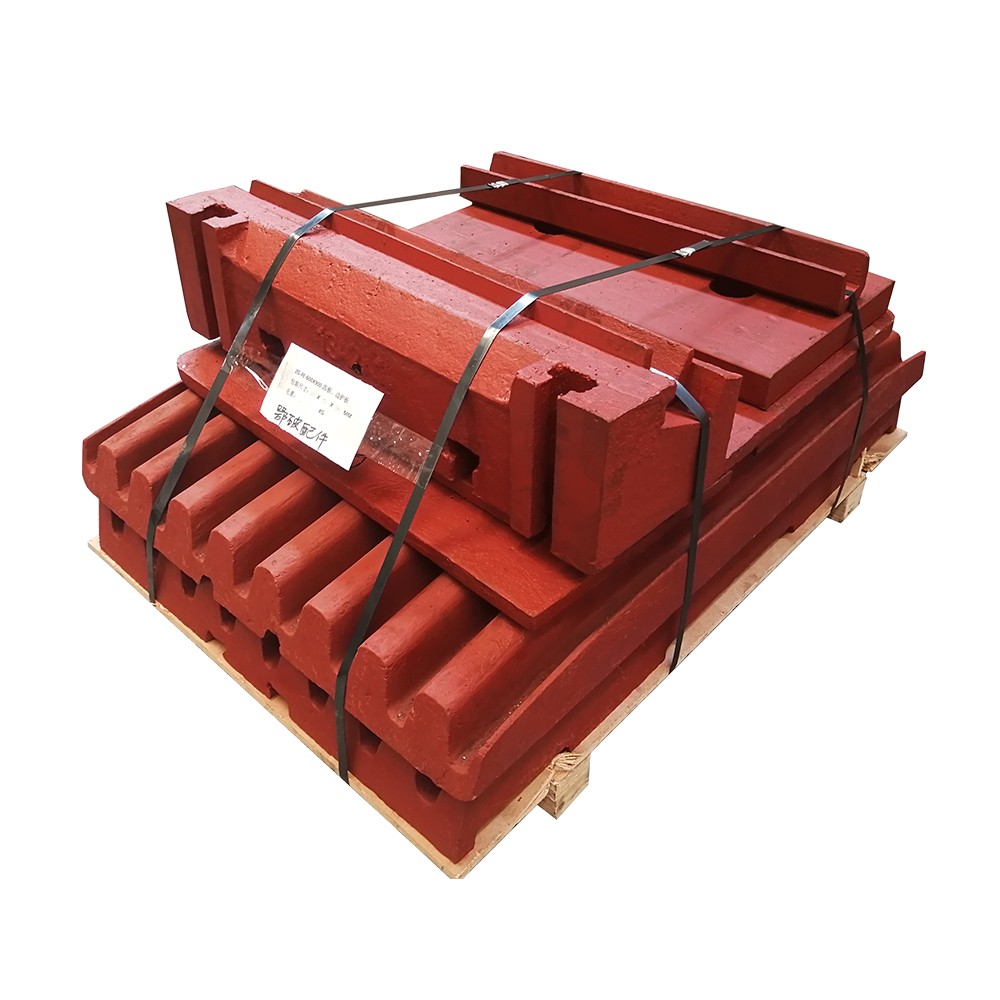-
Zuhause
- Produkte
- Nachrichten
-
Der fall
- Fabrik
-
kontaktiere uns
-
Über uns
- Zertifikat
-
Ausstellung
- China Shenyang Shilong nimmt im Mai 2024 an der Minning EXPO teil
- Vom 20. bis 24. April 2021 nimmt Shilong an der Russian Mining Exhibition in Russland teil.
- Shenyang ShiLong nahm 2020 an der Bauma-Ausstellung in Shanghai teil
- Shenyang Shilong Mechanical nahm weiterhin an der Russland-Ausstellung teil
-
FAQ
- Ist Ihr Unternehmen ein Hersteller oder ein internationales Handelsunternehmen?
- Über welche Produktionsanlagen verfügt Ihr Unternehmen? Wie hoch sind die technischen Stärken?
- Was sind Ihre Hauptprodukte? Und welche Vorteile haben sie?
- Gibt es bei Produkttests für Shilong-Produkte Vorteile?
- Gibt es Vorteile hinsichtlich Produktionszeit und Preis?
- Wie lauten Ihre Versand- und Zahlungsmethoden?
- Verfügt Ihr Unternehmen über Lagerbestände dieser Ersatzteile?
- Service
- Lieferung